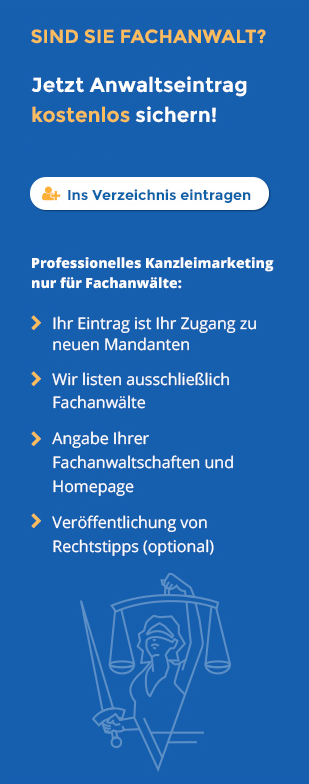Ratgeber: Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht
In zwei Urteilen hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) unter bestimmten Voraussetzungen die Kostentragung für Erhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum zu Lasten einzelner Eigentümer ändern dürfen (Az.: V ZR 81/23 und V ZR 87/23 ). Diese Entscheidung basiert auf dem 2020 reformierten Wohnungseigentumsgesetz. Doppelparker und Dachfenster im Fokus In dem Verfahren V ZR 81/23 ging es um die Kostenverteilung der Reparatur von Doppelparkern, die aufgrund eines Defekts nur eingeschränkt nutzbar waren. Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer beschloss, dass nicht alle, sondern nur die Teileigentümer der ... weiter lesen
Ein Urteil des Landgerichts Hanau (Az.: 2 S 107/22 ) macht deutlich, dass ein Vermieter, der in einem Zweifamilienhaus lebt und die zweite Wohnung nur gelegentlich nutzt, dem anderen Mieter nicht ohne triftigen Grund kündigen darf. Amtsgericht weist Räumungsklage ab Eine Vermieterin, die überwiegend im Ausland residiert, hat mit den Mietern einen Vertrag über eine Wohnung in einem Haus mit zwei Einheiten abgeschlossen. Ihre eigene Wohnung im selben Haus nutzt sie nur vereinzelt im Jahr. Sie sprach eine Kündigung gemäß § 573a BGB aus, die besagt, dass der Eigentümer einer Wohnung in einem selbst bewohnten Gebäude mit höchstens zwei Wohneinheiten das ... weiter lesen
Hat der Verwalter keinen ordnungsmäßigen Vermögensbericht vorgelegt, entspricht ein Entlastungsbeschluss nicht ordnungsmäßiger Verwaltung. Die Jahresabrechnung mit einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung reicht nicht aus (Landgericht Frankfurt am Main v. 09.11.2023 - 2-13 S 3/23) Der Fall : Es ging um die Anfechtung eines Entlastungsbeschlusses, mit dem Argument, der Verwalter habe keinen Vermögensbericht vorgelegt. Der Verwalter verweist auf umfangreiche Abrechnungsunterlagen und eine nachträglich vorgelegte Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Die Entlastung hat die Wirkung eines negativen Schuldanerkenntnisses (§ 397 Abs. 2 BGB) und es werden ... weiter lesen
Karlsruhe (jur). Zwangseintragungen im Grundbuch, etwa zur Anordnung einer Zwangsversteigerung oder der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, bleiben auch nach ihrer „Löschung“ sichtbar. Das geht aus einem aktuell veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe vom 21. September 2023 hervor (Az.: V ZB 17/22). Die Beschwerdeführerin im Streitfall ist Eigentümerin mehrerer Wohnungen in Berlin. Über ihr Vermögen war ein Insolvenzverfahren eröffnet und die Zwangsversteigerung der Wohnungen angeordnet worden. Beides wurde entsprechend gesetzlichen Vorgaben zwangsweise in die Grundbücher eingetragen. Die Eigentümerin konnte aber beide ... weiter lesen
Karlsruhe (jur). Mieterinnen und Mieter einer Nebenwohnung können aus Kostengründen vom Vermieter die Zustimmung zur Untervermietung verlangen. Voraussetzung hierfür ist ein „berechtigtes Interesse“ des Mieters, und dass dieser die Nebenwohnung teilweise selbst weiter nutzt, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Dienstag, 21. November 2023, veröffentlichten Urteil (Az.: VIII ZR 88/22). Für das Recht auf Untervermietung sei es nicht erforderlich, dass die Wohnung nach der Untervermietung noch Lebensmittelpunkt des Mieters bleibt, stellten die Karlsruher Richter klar. Nach den gesetzlichen Bestimmungen können Mieter vom Vermieter verlangen, dass ... weiter lesen
Wer Wohnrecht an einer Immobilie hat, darf sein Leben lang dort wohnen bleiben. In der Regel gilt dies sogar ohne Gegenleistung, wie etwa Mietzahlung. Doch wie gestaltet sich der Hauskauf mit Wohnrecht? Haben ein oder mehrere Personen Anrecht darauf, in dem Haus wohnen zu bleiben, kann der Verkauf deutlich schwieriger werden. Schließlich müssen Sie einige besondere Details beachten. Was genau bedeutet: Hausverkauf mit Wohnrecht? Hausverkauf mit Wohnrecht bedeutet, dass die Immobilie verkauft wird, obwohl andere Anwohner noch das Recht daran haben, in dem Haus zu wohnen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen dem befristeten Wohnrecht und dem Wohnrecht auf Lebenszeit ... weiter lesen
Beleidigungen und der unberechtigte Vorwurf strafbaren Verhaltens rechtfertigen es bei psychisch kranken Mietern nicht ohne Weiteres, ihnen nach § 543 Abs. 1 BGB fristlos zu kündigen (LG Krefeld v. 01.03.2023 - 2 S 27/22) Das Mietverhältnis bestand seit 1984 und verlief bis 2020 störungsfrei. Nachdem die Vermieter dem Mieter eine Betriebskostenabrechnung vorlegten, reagierte dieser schriftlich mit erheblichen Vorwürfen: Die Vermieter hätten ihn und andere Mieter mittels gefälschter Belege betrogen und Gelder veruntreut. Da die Vermieter sich hierdurch beleidigt fühlten, kündigten sie das Mietverhältnis fristlos, hilfsweise ... weiter lesen
Frankfurt/Main (jur). Die verbotene Nähe einer angemieteten Spielhalle zu einer Schule stellt noch keinen Mietmangel und damit kein Grund für eine Mietminderung dar. Nur wenn eine Behörde die Nutzung als Spielhalle untersagt oder ein behördliches Einschreiten zu erwarten ist, kann der illegale Spielhallenbetrieb einen Mietmangel darstellen, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main in einem am Dienstag, 7. November 2023, bekanntgegebenen Urteil (Az.: 2 U 5/23). Im Streitfall hatte die klagende Vermieterin 2012 für zehn Jahre Räumlichkeiten in Büdingen „zur Benutzung als Spielothek/Billard-Sammlung/Wettbüro“ an eine Gesellschaft bürgerlichen ... weiter lesen
Köln (jur). Mieter können an ihrem Balkon bislang keine außenliegenden Solarpaneele ohne Zustimmung des Vermieters anbringen. Denn das von außen angebrachte „Balkonkraftwerk“ stellt ein „gravierender Eingriff“ in das äußere Erscheinungsbild eines Mietobjekts dar, der eine gesetzliche Regelung verlange, entschied das Amtsgericht Köln in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 26. September 2023 (Az.: 222 C 150/23). Das Aufstellen und die Nutzung einer optisch nicht beeinträchtigenden Solaranlage in Bodenhöhe des Balkons könne dagegen nicht untersagt werden. Im Streitfall wollten Mieter aus Köln außen an ihrem Balkon Solarpaneele befestigen. ... weiter lesen
Partylärm nach 22 Uhr kann schnell zu Streitigkeiten unter Nachbarn führen. In Deutschland gilt zwischen 22 und 6 Uhr die Nachtruhe. Sonn- und Feiertags ist Lärm ebenfalls zu vermeiden. In dieser Zeitspanne sollten Sie während des ganzen Jahres Rücksicht auf Ihre Nachbarn nehmen. Die genauen Zeiten der Nachtruhe können je nach Bundesland variieren. In manchen Regionen gilt die Nachtruhe bis 7 Uhr morgens. Partylärm nach 22 Uhr: Was sagt das Gesetz dazu? Die nächtliche Ruhezeit (s. Nachtruhe ) ist in der Regel zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens angesiedelt. So sehen es beispielsweise die Landesimmissionsschutzgesetze der Bundesländer vor. Dabei geht es nicht ... weiter lesen
Immobilien sind als Anlage nach wie vor sehr beliebt und werden häufig als Renditeobjekt erworben und genutzt. Langfristig gesehen haben Kapitalanleger den Vorteil, dass das Objekt selbst einen gewissen Wert besitzt aber auch, dass eine Rendite durch z.B. die Miete erzielt werden kann. Besonders denkmalgeschützte Immobilien stellen eine wichtige und besondere Rolle dar, wenn es darum geht, dass Eigentum erworben und vermietet wird. Der besondere steuerliche Vorteil einer denkmalgeschützten Immobilie liegt darin, dass hier besondere Möglichkeiten der Abschreibung vorhanden sind. Das heißt im Klartext, dass attraktive Steuervorteile genutzt werden können, von denen vor allem ... weiter lesen
Hannover (jur). Ein nachbarliches Grundstück darf nur mit Zustimmung betreten werden. Das gilt selbst dann, wenn Bauarbeiten dort die eigenen Bäume gefährden könnten, entschied das Amtsgericht Hannover in einem am Dienstag, 17. Oktober 2023, bekanntgegebenen Urteil vom Vortag (Az.: 435 C 8845/23). Im konkreten Fall gab es genehmigte Bauarbeiten auf einem Grundstück in Hannover-Isernhagen. Als die Bagger sich in der Nähe der Grundstücksgrenze zu schaffen machten, sorgte sich die Nachbarin um ihre Birke und weitere in der Nähe der Grundstücksgrenze stehende Bäume. Sie ging daher auf das Nachbargrundstück und versuchte, die Baggerführer an ihrer Arbeit zu ... weiter lesen
Karlsruhe (jur). Die Offenbarungspflichten beim Verkauf einer Immobilie sind durch die Übergabe von Dateien oder einem Ordner nicht automatisch erfüllt. Erst recht gilt dies, wenn Dateien in einem Datenraum zur Einsicht bereitgestellt werden, urteilte am Freitag, 15. September 2023, der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe (Az.: V ZR 77/22). Erforderlich ist danach, dass die Verkäuferin „die berechtigte Erwartung haben kann, dass der Käufer durch Einsichtnahme in den Datenraum Kenntnis von dem offenbarungspflichtigen Umstand erlangen wird“. Im entschiedenen Fall hatten die Karlsruher Richter daran Zweifel. Verkauft wurden mehrere Gewerbeeinheiten in einem großen ... weiter lesen
Karlsruhe (jur). Auch Mieter einer Einzimmerwohnung können ein berechtigtes Interesse zur Untervermietung haben, dem der Vermieter zustimmen muss. Voraussetzung ist, dass der Mieter einen Teil der Wohnung weiterhin selbst nutzt, etwa zum Unterstellen eigener Sachen, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Donnerstag, 14. September 2023, bekanntgegebenen Urteil vom Vortag entschied (Az.: VIII ZR 109/22). Im Streitfall geht es um eine Einzimmerwohnung in Berlin. Der Mieter hatte einen längeren Auslandsaufenthalt. Daher wollte er die Wohnung vom 15. Juli 2021 bis zum 30. November 2022 untervermieten. Wenn Mieter „ein berechtigtes Interesse ... weiter lesen
Hanau (jur). Als Einfamilienhaus gilt auch eine Doppelhaushälfte oder ein Reihenhaus. Sieht ein Mietspiegel für die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Einfamilienhäuser einen Zuschlag von 25 Prozent vor, gilt dies auch für eine Doppelhaushälfte, entschied das Amtsgericht Hanau in einem aktuell veröffentlichten Urteil vom 7. Juli 2023 (Az.: 34 C 126/22). Im konkreten Fall wollte ein Vermieter die Nettokaltmiete für seine vermietete 110 Quadratmeter große Doppelhaushälfte mit einer zusätzlichen 20 Quadratmeter großen Terrasse und einem zweiten Bad auf 1.137 Euro erhöhen. Er begründete die beabsichtigte Mieterhöhung mit dem Mietspiegel und der ... weiter lesen
Karlsruhe (jur). Haben Vermieter von Mietern eine zu hohe Miete verlangt und damit gegen die gesetzliche Mietpreisbremse verstoßen, können Ansprüche innerhalb der regelmäßigen gesetzlichen Verjährungsfrist von drei Jahren geltend gemacht werden. Maßgeblich für den Beginn der Verjährungsfrist ist hierbei der Zeitpunkt, an dem der Mieter vom Vermieter Auskunft darüber verlangt, warum die ortsübliche Vergleichsmiete überschritten worden ist wie hoch die Miete des Vormieters war, urteilte am Mittwoch, 12. Juli 2023, der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe (Az.: VIII ZR 375/21 und weitere). Hintergrund des Rechtsstreits ist die gesetzliche Mietpreisbremse. ... weiter lesen
Koblenz (jur). Beim Auszug aus einem Mehrfamilienhaus empfiehlt sich ein schonender Umgang mit dem Aufzug. Denn für die Beseitigung von zwei Kratzern können 13.550 Euro fällig werden, wie das Landgericht Koblenz in einem am Donnerstag, 25. Mai 2023, bekanntgegebenen Urteil entschied (Az.: 4 O 98/21). Im konkreten Fall war die Fahrstuhlkabine innen mit Edelstahl verkleidet. Als der Mieter im November 2019 auszog, entstanden beim Ein- und Ausräumen der Möbel zwei Kratzer an der Rückwand und der linken Seitenwand. Dafür verlangte der Hauseigentümer 13.550 Euro. Die Kratzer könnten nur durch einen kompletten Austausch der beiden Wandbleche beseitigt ... weiter lesen
München (jur). Stirbt die Mieterin einer Wohnung, sollten nicht in den Vertrag aufgenommene Mitbewohner den Vermieter zeitnah darüber informieren. Ein einjähriges schweigen erschüttert das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Mitbewohners und rechtfertigt daher eine Kündigung seitens des Vermieters, wie das Amtsgericht München in einem am Montag, 22. Mai 2023, bekanntgegebenen Urteil entschied (Az.: 417 C 9024/22). Danach muss ein Mann aus München nach Jahrzehnten eine Zweizimmerwohnung im Stadtteil Milbertshofen räumen. Den Mietvertrag hatte 1975 seine Lebensgefährtin abgeschlossen. Als sie im September 2020 starb, hüllte er sich in Schweigen. Erst mehr als ... weiter lesen
Hannover (jur). Eine Hauseigentümerin kann auf ihrem Grundstück nicht einfach Taubenschwärme anlocken, füttern und in Volieren halten. Führen der Kot der Tiere, ihr Gurren und Flügelschlagen zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Nachbarn, hat dieser einen Unterlassungsanspruch, entschied das Amtsgericht Hannover in einem am Mittwoch, 3. Mai 2023, bekanntgegebenen Urteil (Az.: 502 C 7456/22). Auch wenn die Hauseigentümerin aus Tierschutzgründen insbesondere auch kranke Vögel in ihrer Voliere aufnehmen und gesund pflegen will, dürfe damit nicht eine Belästigung der Nachbarn einhergehen. Im Streit stand die Tierliebe einer ... weiter lesen
Frankfurt/Main (jur). Ein sich in einem Hof nackt sonnender Vermieter muss nicht immer ein Mietmangel sein. Ergibt sich durch das Sonnen im Adamskostüm keine „gezielt sittenwidrige Einwirkung“ auf das Grundstück, liegt keine „grob ungehörige Handlung“ vor, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main in einem am Mittwoch, 26. April 2023, bekanntgegebenen Urteil (Az.: 2 U 43/22). Nur weil das „ästhetische Empfinden“ eines Nachbarn gestört wird, werde die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache nicht beeinträchtigt. Im Streitfall hatte der Kläger eine Büroetage im Frankfurter Westend vermietet. Der Vermieter nutzte das Gebäude auch selbst als ... weiter lesen